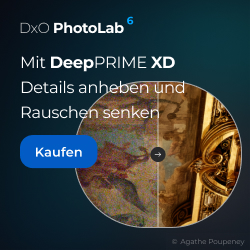Alles über den äusserst lästigen Bildfehler in der digitalen Fotografie
Analog oder digital – die Grenzen des Machbaren
Man kann die Frage, ob Fotos mit der Digitalisierung der Fotografie besser geworden sind, nur ambivalent beantworten: „Es kommt drauf an“. Grade bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen wird die Qualität eines Fotos häufig durch Bildrauschen verhagelt. Man kommt da an eine Grenze bei schwindendem Licht, und die Physik lässt sich nicht aushebeln.
Die Fotografen der „National Geographic“ erstellten mit ihren niedrigempfindlichen Kodachrome-Filmen Reportagen von legendärer Qualität, als es nämlich noch keine Digitalkameras gab. Das schafften sie Monat für Monat, aus jedem Teil der Erde. Der bekannte amerikanische Fotojournalist Steve McCurry, der jahrelang Kodachrome Filme verwendete, erhielt 2010 von Kodak die letzte Rolle. Danach wurde Produktion und Filmentwicklung von Kodachrome eingestellt.
Ob die Sensoren heutiger Digitalkameras auch nur annähernd an die Schärfe und Detailtreue eines Kodachrome 25 oder 64 Films herankommen, darf bezweifelt werden. Doch Schärfe ist nicht alles. Und wer bitte fotografiert heute noch mit ISO 64 oder gar 25? Die Stärken der Digitalfotografie sind universeller, die Anforderungen an die Nachbearbeitung anspruchsvoller.
Steve McCurry dazu:
„Mit digitaler Fotografie gewinnt man viele Vorteile, aber man braucht eine Nachbearbeitung. Mit Kodachrome bekommt man auf Anhieb brillante Bilder.“
Wie Bildrauschen entsteht…
In der digitalen Fotografie arbeitet man mit lichtempfindlichen Sensoren, deren Empfindlichkeit frei wählbar ist. Viele Kameras machen das automatisch. Die Empfindlichkeit wird in ISO angegeben in den gängigen Abstufungen
ISO 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800 – 25600
Eine Verdoppelung des ISO-Wertes entspricht einer Verdoppelung der Empfindlichkeit. Ebenso wie bei der analogen Fotografie müssen hohe ISO-Werte allerdings mit verminderter Bildqualität bezahlt werden: je höher die Empfindlichkeit, desto stärker das Bildrauschen.
Bildrauschen tritt üblicherweise bei Aufnahmen mit wenig Licht auf, wenn der Sensor auf eine hohe Lichtempfindlichkeit eingestellt ist oder lange belichtet wird.
Man unterscheidet zwei Arten von Bildrauschen:
1. Langzeitrauschen entsteht durch lange Belichtungszeiten. Sichtbares Langzeitrauschen setzt ab etwa 1 sec. ein und wird stärker, je länger die Belichtung dauert.
Es gibt kameraseitig mehrere Verfahren zur Verminderung von Langzeitrauschen, teils während und teils nach der Aufnahme. So erzeugen einigen Kameras unmittelbar nach der Aufnahme eine Dunkelaufnahme, die die eigentliche Aufnahme passgenau überlagert. Dieser Vorgang dauert noch einmal so lange wie die ursprüngliche Belichtung. Damit können Störungen erkannt und herausgerechnet werden. Eine andere Technik ist die Kühlung des Sensors während der Aufnahme, die bei wissenschaftlichen Kameras, etwa in der Astronomie, und bei Wärmebildkameras eingesetzt wird. Langzeit-Rauschen kann also bereits in der Kamera reduziert werden.
Einige Kameras bieten an, statt einer Langzeitbelichtung viele Kurzzeitbelichtungen zu machen, die noch in der Kamera elektronisch zusammengefügt werden. Dabei wird durch Versetzen der Pixel die Auflösung erhöht (HiRes). Dass diese Verfahren den Einsatz eines Stativs voraussetzen, versteht sich.
2. Pixelrauschen (auch ISO-Rauschen) wird durch die Pixelgröße und den Pixelabstand des Bildsensors beeinflusst und nimmt mit höherer ISO-Einstellung zu. Grössere Sensoren mit grösseren Pixeln und grösserem Pixelabstand sind im Vorteil. Manche Hersteller hochwertiger Kameras reduzieren dafür sogar die Zahl der Pixel und damit die Auflösung.
Die Qualität der Sensoren entscheidet letztlich darüber, bei welchem ISO-Wert das Bildrauschen störend wird. Leider lassen sich Detailverluste durch Pixelrauschen nicht wirklich ausgleichen. Bei einer individuellen Nachbearbeitung kann zwar das Rauschen unterdrückt werden, das hat aber Verluste bei Schärfe und Kontrast zur Folge.
Ein unkontrolliertes Hochfahren der Sensor-Empfindlichkeit bei Nachtaufnahmen sollte also vermieden werden. Stattdessen sollte man lieber eine niedrigere Empfindlichkeit manuell einstellen und zum Stativ greifen.
… wie man es vermeidet …
Das wäre natürlich das beste, wenn Bildrauschen erst garnicht entstünde. Was bereits bei der Aufnahme hilft, ist leider nicht immer möglich:
- Die Aufnahme mit mehr vorhandenem Licht wiederholen
- Die Aufnahme mit einem lichtstarken Objektiv wiederholen
- Eine Kamera mit grösserem Sensor verwenden
Wer immer wieder Probleme mit Bildrauschen hat, wird vielleicht seine Ausrüstung überprüfen wollen. Bei unseren Kamera-Empfehlungen haben wir dem Bildrauschen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
… und was dagegen hilft
In allen anderen Fällen wirst du dir mit der Nachbearbeitung behelfen müssen. Bildbearbeitungsprogramme bieten in aller Regel Funktionen zur Rauschunterdrückung an (DxO Photolab, Topaz DeNoise, Lightroom, ACDSee u. a.). Im Prinzip geht jeder Rauschfilter mit einem Detailverlust einher und jedes Bild muss einzeln behandelt werden, was zeitaufwändig ist und nicht immer zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt.
Inzwischen arbeiten mehrere Bildbearbeitungsprogramme automatisch und filtern mit Unterstützung von KI gezielt die verrauschten Bildpartien heraus. Ich arbeite seit kurzem mit DxO Photolab 6, mit dem eine automatische Entwicklung von RAW-Dateien, Bildoptimierung und Rauschentfernung bei gleichzeitigem Detail-Erhalt möglich ist. Die bearbeiteten Fotos können in TIFF, DNG oder JPEG in lokale Ordner exportiert werden. Von dort kann geliefert, gepostet oder auch mit anderen Bildbearbeitungsprogrammen weiter gearbeitet werden. Dabei bleibt das RAW-Bild unverändert. Einen Link zu mehr Informationen und zum Kauf der Software findest du rechts.
TIPP:
- Begrenze die automatische ISO-Einstellung der Kamera auf eine Spanne, die normalerweise ausreicht, z. B. von ISO 100 – ISO 400, bei grösseren Sensoren bis maximal bis ISO 1600.
- Lege eine feste Voreinstellung einer Kamerafunktion, die hilfreich sein kann (z. B. Hochauflösung), auf eine programmierbare Individualfunktion. So findest du die richtige Einstellung auch im Dunkeln.
- Nachbearbeitung mit einem geeigneten Bildbearbeitungsprogramm (wir benutzen DxO Photolab und ACDSee pro).
- Wer immer wieder Nachtaufnahmen macht und vielleicht sogar darauf spezialisiert ist, sollte sich für diesen Zweck eine Vollformatkamera oder eine APS-C Kamera zulegen sowie ein Objektiv mit geeigneter Festbrennweite und grosser Blendenöffnung (möglichst 2,0 oder besser).
Diese Artikel vermitteln Grundlagen:





Unsere Programme zur Rauschreduzierung:
Affiliate-Links sind mit einem * gekennzeichnet. Sei so nett und nutze unsere Links für deine Bestellung! Wir erhalten dann vom Händler eine Provision, von jedem ein bisschen. Das sichert unsere Unabhängigkeit, und du hilfst uns damit, diese Webseite zu finanzieren.